Das traditionelle Rollenbild gerät zunehmend ins Wanken. Beim Bildungsniveau liegen Frauen inzwischen vorne, bei Erwerbsbeteiligung und Einkommen holen sie weiter auf. Trotzdem scheint der Haushalt nach wie vor eine klassische Frauendomäne zu sein. Selbst wenn beide Partner in Vollzeit arbeiten, erledigt die Frau häufig den Löwenanteil der Hausarbeit.
Ein gängiger Erklärungsansatz von Ökonomen und Soziologen basiert auf dem Konzept der „internalisierten Gendernormen“. Soll heißen: Im Vergleich zu Männern empfinden Frauen die Hausarbeit als erfüllender – oder zumindest als weniger lästig. Tatsächlich legen Umfragen zur subjektiven Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitspensum nahe, dass viele Frauen gar nichts am Status quo ändern wollen.
In einem aktuellen IZA-Diskussionspapier zweifeln Katrin Auspurg, Maria Iacovou und Cheti Nicoletti die Aussagekraft solcher Umfragen aus dreierlei Gründen an: Erstens wird das „Hausmann“-Modell noch zu selten praktiziert, um zuverlässige Rückschlüsse auf dessen Akzeptanz zu ziehen. Zweitens könnte das psychologische Phänomen der „nachträglichen Rationalisierung“ eine Rolle spielen (vereinfacht gesagt: Frauen reden sich die Hausarbeit schön). Und drittens lassen sich Ursache-Wirkungs-Beziehungen schwer beurteilen.
Die Autorinnen wählen daher einen alternativen Ansatz: Im Rahmen des britischen Innovation Panel of Understanding Society wurden rund 1.600 Männer und Frauen vor hypothetische Szenarien gestellt, die neben der Verteilung von Erwerbs- und Hausarbeit auch Aspekte wie Einkommen, Familienzusammensetzung und bezahlte Haushaltshilfen abbildeten. Auf einer Skala von 1 bis 7 sollten die Befragten ihre Zufriedenheit mit unterschiedlichen Varianten der Arbeitsverteilung ausdrücken. Sie sollten also nicht ihre eigene Situation bewerten, sondern mögliche Alternativen. [Read more…] about Das bisschen Haushalt… immer noch größtenteils Frauensache

 Erwerbstätige Frauen aus Zuwandererfamilien hatten lange Zeit den Stempel der reinen „Zuverdienerin“, die aus der finanziellen Notwendigkeit heraus eine schlecht bezahlte Tätigkeit annimmt, solange ihr Ehemann noch nicht ausreichend qualifiziert und integriert ist, um die Familie alleine ernähren zu können. Dieses Bild hat sich inzwischen deutlich gewandelt, wie ein aktuelles IZA-Diskussionspapier am Beispiel Kanadas zeigt.
Erwerbstätige Frauen aus Zuwandererfamilien hatten lange Zeit den Stempel der reinen „Zuverdienerin“, die aus der finanziellen Notwendigkeit heraus eine schlecht bezahlte Tätigkeit annimmt, solange ihr Ehemann noch nicht ausreichend qualifiziert und integriert ist, um die Familie alleine ernähren zu können. Dieses Bild hat sich inzwischen deutlich gewandelt, wie ein aktuelles IZA-Diskussionspapier am Beispiel Kanadas zeigt.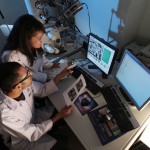 Die Zeiten haben sich geändert: Firmenchefs setzen ihre Teams mittlerweile häufig bewusst „bunt“ zusammen, weil sie wissen, dass ein Migrationshintergrund eine wertvolle Zusatzqualifikation sein und ethnische Vielfalt die Produktivität steigern kann. Dass diese Diversität auch in der Wissenschaft von Vorteil ist, zeigen IZA-Preisträger
Die Zeiten haben sich geändert: Firmenchefs setzen ihre Teams mittlerweile häufig bewusst „bunt“ zusammen, weil sie wissen, dass ein Migrationshintergrund eine wertvolle Zusatzqualifikation sein und ethnische Vielfalt die Produktivität steigern kann. Dass diese Diversität auch in der Wissenschaft von Vorteil ist, zeigen IZA-Preisträger  Viele Arbeitgeber bieten ihren Beschäftigten inzwischen mehr Flexibilität bezüglich Arbeitszeit und Arbeitsort. Das ist nicht nicht ganz uneigennützig, denn gerade die knappen Fachkräfte fordern immer häufiger eine bessere „Work-Life-Balance“ ein. Aber machen flexible Arbeitszeiten und Home Office wirklich glücklicher?
Viele Arbeitgeber bieten ihren Beschäftigten inzwischen mehr Flexibilität bezüglich Arbeitszeit und Arbeitsort. Das ist nicht nicht ganz uneigennützig, denn gerade die knappen Fachkräfte fordern immer häufiger eine bessere „Work-Life-Balance“ ein. Aber machen flexible Arbeitszeiten und Home Office wirklich glücklicher?
 Der Ruhestand bedeutet nicht nur für die Betroffenen einen tiefen Einschnitt, sondern mitunter für die ganze Familie. Häufig berichten Ehefrauen von Depressionen, Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit, nachdem ihre Männer aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind. Dieses Phänomen, auch als „
Der Ruhestand bedeutet nicht nur für die Betroffenen einen tiefen Einschnitt, sondern mitunter für die ganze Familie. Häufig berichten Ehefrauen von Depressionen, Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit, nachdem ihre Männer aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind. Dieses Phänomen, auch als „